Ein Faber und ein Cave
Ein Wochenende in Montreux
Bei der Statue von Freddie Mercury am Seeufer in Montreux liegen wie immer Blumen. Tausende flanieren auf der Promenade. Strassenmusikanten spielen. Julian Pollina, als Faber bekannt, sitzt auf einer Steinbank vor dem dem Musik & Convention Center, fast niemand erkennt ihn, er versteckt seinen Kopf in sein Handy. In einer Stunde tritt er auf, jetzt steht Dino Brandão, sein Freund, mit der Gitarre auf der Bühne, nachher auch Sophie Hunger, die er einmal, er war noch ganz jung, auf dem Lindenhof in Zürich getroffen und gefragt hatte, ob er mal vorsingen dürfe. Er durfte. Und Faber ist inzwischen selber ein Star. Julian, Sophie, sie wird bald Mutter, und Dino werden an diesem Freitagabend, auch zusammen auftreten, «Derfi di hebe», ein grossartiges Lied, singen sie, sie traten damit schon der Hamburger Elbphilharmonie auf. Zuletzt spielt Faber bis morgens fast um ein Uhr in der ehemaligen Miles Davis Hall.
Und am anderen Tag, die Sonne scheint noch stärker über dem Genfersee, strömen die Leute abends in das Auditorium Stravinski, es ist stickig heiss, Körper an Körper stehen sie, und an Corona kann (und darf) niemand denken. Was sie erleben, ist, ich suche Worte: ekstatisch, verstörend, berauschend, emotional, aufwühlend. Ein Wahnsinniger steht auf der Bühne, Nick Cave, Australier, bald 65.
Er singt, er stampft, er beschwört, er predigt, er fleht, er sucht Nähe, ständig, sucht Hände, die ihn tragen, ich brauche euch, sagt und schreit er immer wieder, und er meint es ernst, es scheint symbolisch, er hatte in seinem Leben schon viele Schicksalsschläge erleben müssen, erst vor kurzem seinen zweiten Sohn verloren. Er sucht Halt, so wirkt es. Cave and the Bad Seeds elektrisieren mit ihrer Musik, Nick Cave nimmt ständig ein weisses Tuch, legt es um seinen Kopf, weil er so schwitzt, in seinem Dreiteiler-Anzug und weissem Hemd, er ist ein Entertainer, der zwischendurch auch seine berührenden Baladen singt, Geschichten erzählt voller Schmerz, Leid und Sehnsucht, und dann wieder wie ein Irrwisch dem Bühnenrand entlang rennt und stampft und Hände sucht und Gesichter fixiert.
Pflotschnass verlassen wir alle weit nach Mitternacht den Saal. Immer noch verstört, entrückt. «You are a living hero!» schrie eine Zuhörerin. Und wir denken: Ein seltsamer Mensch ist er. Aber grossartig.
Und das sind meine Bilder eines unvergesslichen Wochenendes in Montreux, beim Start zum 56. Jazz Festival. Zwischen Cave und Faber, von dem Musikkritiker sagen, es sei mit seinen Songs ein bisschen Cohen, ein bisschen Winehouse, ein bisschen Brel oder Gainsbourg – und auch ein bisschen Cave.
Faber singt Caruso, das Lied von Lucio Dalla
«Cry, cry, cry»
Pflotschnass und entzückt nach zweieinhalb Stunden
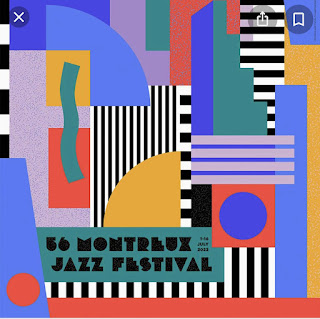

































Kommentare
Kommentar veröffentlichen